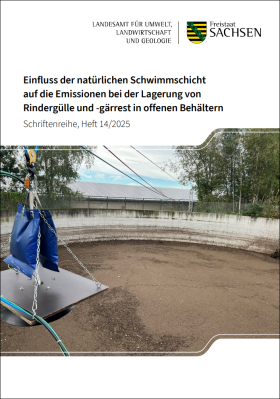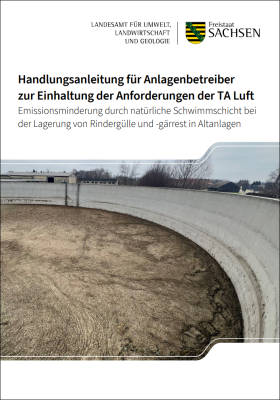Emissionen in der Tierhaltung
Emissionen offener Rindergülle- und Gärrestlager - Einfluss der natürlichen Schwimmschicht
In Deutschland stammen etwa 92 % der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft, insbesondere aus Tierhaltung, Ausbringung und Lagerung von Wirtschaftsdüngern. Die Lagerung trägt in der Milchproduktion rund 10 % und bei allen Nutztieren etwa 18 % zur Ammoniakemission bei. Gemäß TA LUFT (2021) sollen Emissionen bezüglich Ammoniak und Geruch bei der Lagerung von Gülle oder Gärrest um mindestens 90 % (Altanlagen mindestens 85 %) gegenüber offenen Behältern reduziert werden.
In den vorliegenden Untersuchungen wurde der Einfluss natürlicher Schwimmschichten auf die Emissionsminderung bei der Lagerung von Rindergülle und -gärrest in verschiedenen Behältertypen unter Praxisbedingungen analysiert. An insgesamt 29 Messtagen, verteilt auf verschiedene Jahreszeiten, wurden mittels FTIR-Spektrometrie die Emissionen von Ammoniak, Methan, Lachgas und Kohlendioxid erfasst sowie Geruchsproben entnommen. Die natürliche Schwimmschicht wurde hinsichtlich ihrer Dicke, ihres Zustands und ihrer Geschlossenheit kategorisiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass geschlossene Schwimmschichten mit einer Dicke von über 10 cm die Ammoniakemissionen bei Rindergülle um etwa 95 % und bei Rindergärrest um 99 % reduzieren können. Auch Schwimmschichten geringerer Dicke bewirkten bereits eine deutliche Reduktion. Die Geruchsemissionen wurden bei Rindergülle um 94 % und bei Rindergärrest um bis zu 98 % reduziert, wobei Rindergärrest eine geringere Geruchsintensität als Rindergülle aufwies.
Die Untersuchungen bestätigen, dass stabile Schwimmschichten mit einer Dicke von über 10 cm die Anforderungen der TA LUFT (2021) erfüllen und als gleichwertige Maßnahme zur Emissionsminderung anerkannt werden können.
Ein gezieltes Management zur Förderung und Erhaltung der Schwimmschicht ist dabei unerlässlich. Zu diesem Zweck wurde eine Handlungsanleitung für Anlagenbetreiber entwickelt, die verbindliche Vorgaben zum Handling der Gülle- und Gärrestlagerung gibt und als Überwachungsmöglichkeit ein Kontrollprotokoll mit Fotodokumentation vorsieht.
Veröffentlichung des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vom 27. Juni 2025
Darstellung der Vorgehensweise der sächsischen Behörden zur Anerkennung der natürlichen Schwimmschicht als emissionsmindernde Maßnahme bei Rindergülle und Rindergärrest gemäß den Anforderungen der TA Luft
Veranstaltungsnachlese
Online-Infoveranstaltung zur »Nutzung der natürlichen Schwimmschicht bei der Lagerung von Rindergülle und -gärrest in Altanlagen« am 3. Juli 2025
Zu den Vorträgen:
- Intakte natürliche Schwimmschichten als emissionsmindernde Maßnahme in Rindergülle und Gärrestanlagen (*.pdf, 4,75 MB) Heike Harzer, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Landwirtschaft und Geologie, Referat 74 Köllitsch
- Umsetzung der TA Luft 2021 - weiteres Vorgehen bei der Lagerung von Rindergülle und -gärrest in Sachsen (*.pdf, 0,82 MB) Harald Jendrike, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat 46
- Praxisbericht zum Umgang mit natürlichen Schwimmschichten von Rindergülle- und gärrest – Bewertung der alternativen Maßnahme (*.pdf, 2,32 MB) Diana Koban, Bauernland AG
Zur Beantwortung der Chatfragen:
Maßnahmen zur Bildung einer emissionsmindernden natürlichen Schwimmschicht – organisatorische Vorgaben gemäß der Handlungsanleitung
- Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung einer geschlossenen, trockenen emissionsmindernden Schwimmschicht mit einer Dicke von mindestens 10 cm
- vollständige Zerstörung der Schwimmschicht maximal 2x im Jahr,
idealerweise während der Hauptausbringezeiträume im Frühjahr und Herbst,
bevorzugt in Kombination mit der vollständigen Entleerung des Lagerbehälters - Homogenisierung nur in Verbindung mit einer Entnahme von Gülle und Gärresten
- Entnahme von Teilmengen ohne Zerstörung der Schwimmschicht
- Reduzierung von Pump- und Umpumpvorgängen
- Einsatz leistungsfähiger Rührwerke, Umsetzung kurzer Rührzeiten
- Erstellung einer Betriebsanweisung für die Gülle- und Gärrestlagerung
- Benennung eines Mitarbeiters, der für die Gülle- und Gärrestlagerung verantwortlich ist
- Erfassung und Kontrolle der emissionsmindernden Schwimmschicht pro Lagerbehälter
(Kontrollprotokoll für jeden Lagerbehälter mit Fotos der Behälteroberfläche)
Veranstaltungen des LfULG
Kontakt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 74: Tierhaltung
Heike Harzer
Telefon: 034222 462214
Telefax: 034222 462099
E-Mail: Heike.Harzer@lfulg.sachsen.de